Verdacht und Vorurteil

An ihren Aushilfsjob im Callcenter eines Frankfurter Vermögensverwalters erinnert sich Hilal Akdeniz ungern. Schon nach wenigen Tagen hatte die damalige Schülerin ein Gespräch beim Chef. Sein Wunsch: Sie solle in den Telefonaten doch bitte einen anderen Namen wählen. Müller, Meier, Schmidt – egal, Hauptsache er klingt deutsch. Ihr türkischer Name würde Kunden verschrecken. "Das hat mir ein Stück meiner Identität geraubt“, sagt die 41-Jährige heute. Schließlich sei sie deutsche Staatsbürgerin, hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und trotzdem sollte sie nicht ihren Namen verwenden.
Mit ihren Erfahrungen ist Akdeniz nicht allein. Besonders in Bewerbungsverfahren haben es Frauen mit türkischem Namen oder Kopftuch schwer. Im Schnitt müssen sie laut einer Studie des Institute of Labor Economics (IZA) aus Bonn bei gleicher Qualifikation rund viermal mehr Bewerbungen schreiben als nichtmuslimische Frauen, um zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Manche Bewerberinnen werden sogar offen angefeindet: Im Dezember 2019 sprach das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz einer alleinerziehenden Mutter eine Entschädigung zu, die sich, nach einem abgebrochenen Studium, auf eine Ausbildungsstelle bei einem Steuerberater beworben hatte. Auf ihrem Bewerbungsfoto trug sie ein Kopftuch.
Der Steuerberater lehnte die Bewerbung ab. Seine Begründung: "Ich gehe davon aus, dass Ihre Bewerbung wohl nicht ganz ernst gemeint war und Sie wohl nur ein Alibischreiben für ALG II verfasst haben.“ Und weiter: "Sollten Sie wirklich mal eine ernstzunehmende Bewerbung schreiben wollen, verzichten Sie auf Ihren ‚Kopfschmuck‘.“
Solche Anfeindungen sind vermutlich Einzelfälle, aber viele Arbeitgeber scheinen zumindest unterbewusst Religionszugehörigkeit als wichtiges Kriterium bei der Mitarbeiterauswahl zu betrachten. "Viele Arbeitgeber verbinden mit dem Islam erst mal Unsicherheit und potentielle Konflikte in der Belegschaft“, sagt Yasemin El-Menouar, Islamwissenschaftlerin und Leiterin des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung. Das hindere sie daran, muslimische Mitarbeiter einzustellen. Arbeitnehmer muslimischen Glaubens spüren das: 27 Prozent berichten laut einer EU-weiten Umfrage der Europäischen Grundrechte-Agentur von regelmäßiger Diskriminierung am Arbeitsplatz.
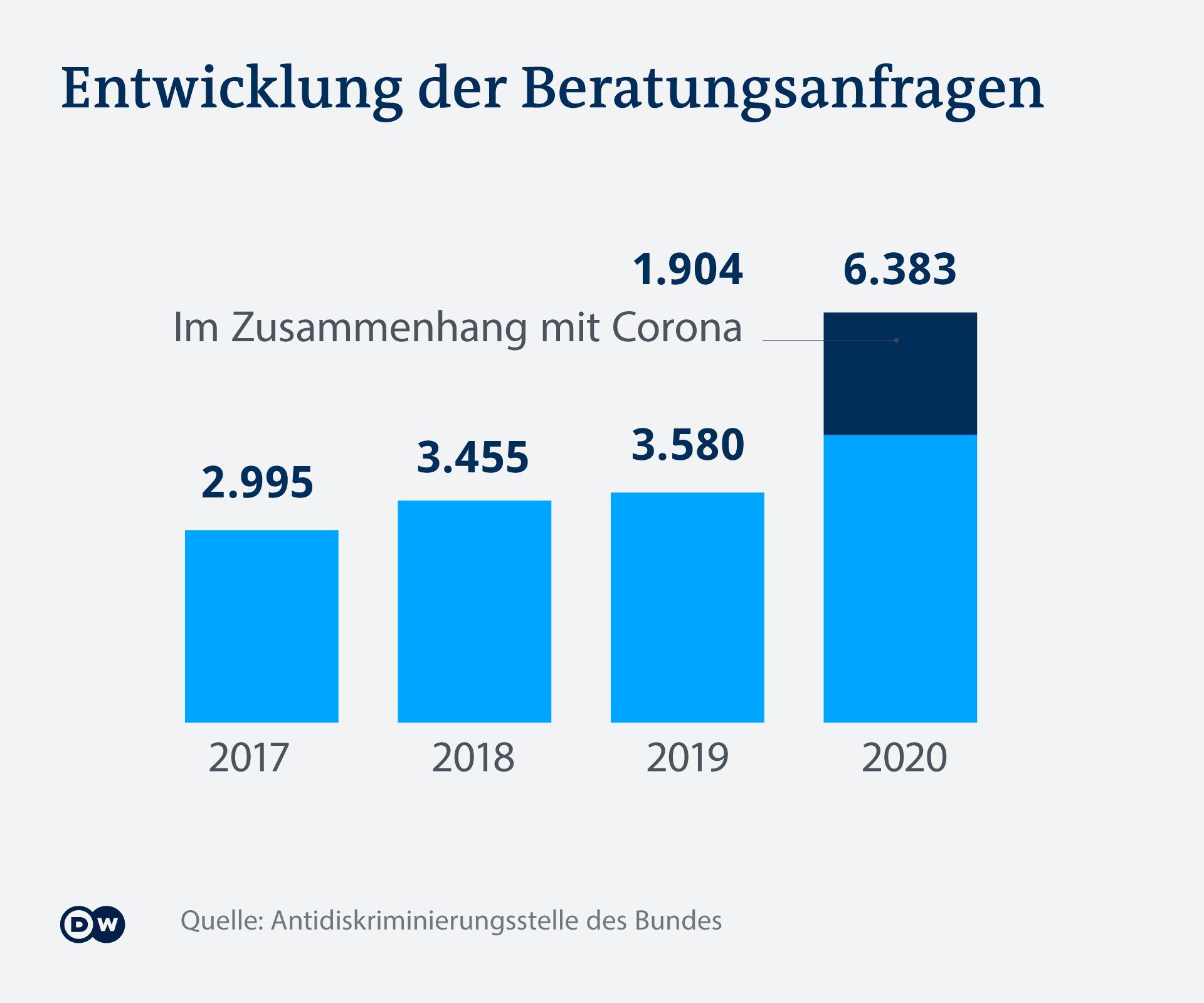
Ganz uneigennützig sind diese Maßnahmen nicht
Aber warum haben muslimische Arbeitnehmer so einen schweren Stand? "Der Islam hat ein Imageproblem“, sagt El-Menouar. Berichte über islamistischen Terror und Menschenrechtsverletzungen beeinflussen die Wahrnehmung des Islam in der Öffentlichkeit. Das zeige sich auch bei der Arbeit. "Manche Menschen haben Bilder im Kopf, die mit der Realität nichts zu tun haben“, so El-Menouar. Unternehmen müssten ihre Belegschaft deshalb vor allem aufklären und Transparenz schaffen. Besonders in Unternehmen, in denen viele Glaubensgemeinschaften zusammenkämen.
So wie am Frankfurter Flughafen zum Beispiel. Dort arbeiten rund 81.000 Beschäftigte aus 88 Nationen. In zehn Gebetsräumen können Muslime, Christen und Juden beten. Für muslimische Arbeiter, die vor allem draußen auf dem Rollfeld arbeiten, hat das Unternehmen kleine Gebetsnischen in den Vorfeldgebäuden eingerichtet. "Wir erlauben unseren Mitarbeitern zu beten, aber der reibungslose Betriebsablauf hat Vorrang“, sagt Christian Meyer, Diversity Manager bei der Betreibergesellschaft Fraport. Seit Jahren baut Fraport während des Ramadan in einer Veranstaltungshalle ein großes Buffet auf. Hier können gläubige Muslime nach Sonnenuntergang gemeinsam essen.
Ganz uneigennützig sind diese Maßnahmen nicht. "Ich glaube, dass unsere Mitarbeiter motivierter und ausgeglichener sind als anderswo“, sagt Meyer. Das wirke sich positiv auf die Leistung aus. Und auch die Fluggäste aus aller Welt erwarten von einem internationalen Flughafen entsprechende Angebote. Religiöse Toleranz kann also auch ein wirtschaftlicher Faktor sein. El-Menouar von der Bertelsmann Stiftung sieht das ähnlich: "Bei der Suche nach Fachkräften aus dem Ausland spielt die religiöse Diversität eine enorm wichtige Rolle.“ Arbeitgeber sollten klar Position beziehen und religiöse Vielfalt in Leitbild und Strategie des Unternehmens festschreiben.
Auch für Hilal Akdeniz war religiöse Toleranz bei ihrer Berufswahl ein wichtiger Faktor. Ihren Aushilfsjob im Callcenter kündigte sie nach wenigen Wochen. Nach ihrem Abitur studierte sie Soziologie und arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Doch auch dort spürte sie Anfeindungen. In einem Tutorium, das sie leitete, forderte ein Student sie auf, ihr Kopftuch abzulegen. Er fühle sich dadurch gestört.
"Ich war erst mal total baff, habe mein Kopftuch aber natürlich angelassen“, sagt sie. Inzwischen arbeitet sie bei einer muslimischen Stiftung in Berlin. Einer der Vorteile unter den Kollegen dort: „Wenn wir zusammen essen gehen, muss ich jetzt nicht mehr jedes Mal erklären, warum ich kein Schweinefleisch esse oder keinen Alkohol trinke.“
Martin Lechtape
© Frankfurter Allgemeine Zeitung 2021
