"Ich bin schockiert, trauere und hoffe“

Ihr erster Roman ist durch einen Zufall entstanden. Sie waren in einem Café in Jerusalem und warteten auf jemanden. Wissen Sie noch, wer das war?
Zeruya Shalev: Ja, ich hatte erst kurz zuvor begonnen, als Verlagslektorin zu arbeiten, und wartete auf einen Autor, dessen Buch ich lektoriert hatte. Ich weiß noch, wer das war, aber der Name tut nichts zur Sache. Er hat seitdem nur noch ein weiteres Buch veröffentlicht.
Es gab noch keine Mobiltelefone, und Sie fingen auf der Rückseite seines Manuskripts an zu schreiben. Waren dies Ihre ersten Sätze als Romanautorin? Und die ersten Seiten Ihres Buchs „Nicht ich“?
Shalev: Ja, die ersten Seiten des Romans sind genau so geblieben, wie ich sie damals in einem völlig unerwarteten Ausbruch von Inspiration geschrieben habe. Ich dachte, das würde wieder ein Gedicht werden, aber dann sah ich, die Zeilen hörten einfach nicht auf, sie wurden immer länger und bekamen einen ganz anderen Rhythmus. Ich wusste nicht, dass das ein Roman werden würde, und hatte erst recht keine Ahnung, wie er sich entwickeln würde. Es passierte mir natürlich nicht zum ersten Mal, dass ich Wörter und Sätze schrieb und nicht verstand, woher sie kamen und wohin sie führen, aber zum ersten Mal brachten sie mich von der Lyrik weg zur Prosa.
Der Roman erscheint erst jetzt auf Deutsch, ist damals, 1993, aber in Israel erschienen. Wie waren die Reaktionen?
Shalev: Er wurde sehr kühl aufgenommen. Genauer gesagt, sehr hitzig, denn die meisten Besprechungen waren wütend und oft auch richtig aggressiv: eine moralische Verurteilung der Heldin und im Grunde der Autorin, ihres Charakters und ihrer Entscheidungen. Mit den Jahren wandelte sich diese Einstellung. Erste Forschungsarbeiten wurden über das Buch geschrieben, und bis heute überrascht es mich, wenn mir Leser sagen, dass sie diesen Roman mehr mögen als alle meine anderen Bücher. Aber in der ersten Zeit hatte ich das Gefühl, dass die Kritik die Leser abgeschreckt hat. Als es noch kein Internet gab, besaßen Kritiker eine enorme Macht.
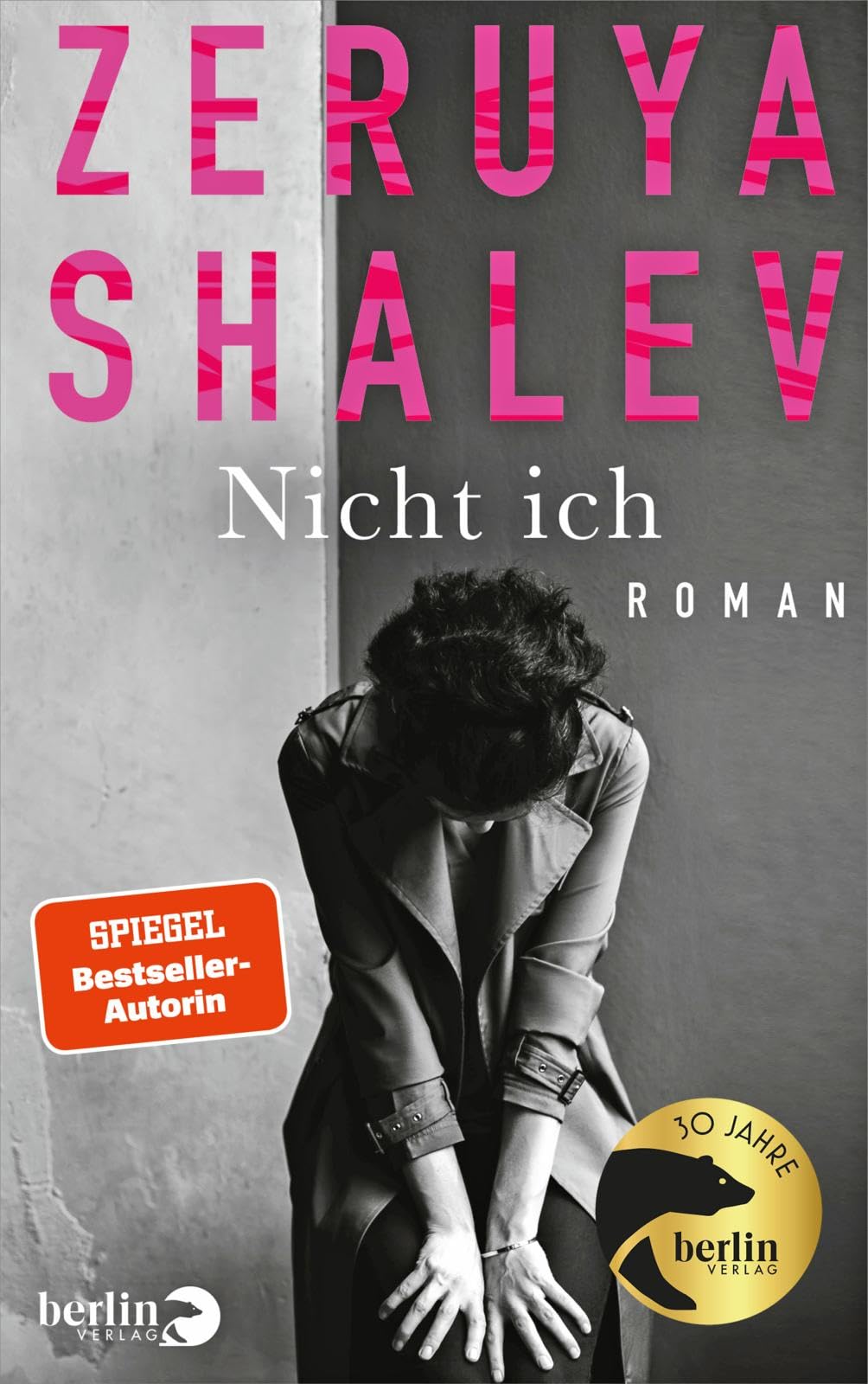
Die "frische Luft des Scheiterns"
Hat Sie die Ablehnung damals eingeschüchtert oder ermutigt?
Shalev: Ich gebe zu, diese Kritik hat mich tief erschüttert. Es tat weh, zu sehen, dass das Buch, das ich mit Leidenschaft geschrieben hatte, so gedemütigt wurde. Ich war jung, unsicher und unerfahren, und ziemlich bald glaubte ich den Kritiken und verlor den Glauben an das Buch und an mich als Autorin. Ich beschloss, nur noch Lyrik zu schreiben, aber die Wörter kamen nicht mehr. Ich hatte Angst, die Autoren des Verlags könnten mir nicht mehr vertrauen und ich würde meine Arbeit als Lektorin verlieren. Wenn ich am Wochenende im Laden an der Ecke die ausliegenden Zeitungen sah, zitterte ich vor Angst, dort wieder eine verletzende, vernichtende Kritik zu finden. Wenn ich zurückschaue, kann ich dennoch sagen, dass das Ganze auch etwas Befreiendes hatte.
Als ich anfing, „Liebesleben“ zu schreiben, spürte ich keine der Erwartungen und Ängste, die ich beim Schreiben von „Nicht ich“ erlebt hatte. Anscheinend hatte ich mir die Lungen genügend vollgesogen mit der „frischen Luft des Scheiterns“, wie Samuel Beckett es im „Molloy“ so genial formuliert.
„Liebesleben“, das später von Maria Schrader verfilmt wurde, hat sie weltberühmt gemacht. Wann haben Sie mit dem Schreiben daran begonnen?
Shalev: Ich brauchte über zwei Jahre, um mich von der Kritik zu erholen, und es gab da keine bewusste Entscheidung. Irgendwann hatte ich einige Sätze im Kopf, die mir keine Ruhe mehr ließen, bis ich sie aufschrieb. Ich habe mich so dermaßen gefreut, dass die Wörter zurückkamen. Ich genoss die Inspiration und machte mir keine Gedanken, wie es ankommt. Und wenn ich einen Moment doch mal daran dachte, so hatte ich keine großen Erwartungen. Ich war mir noch nicht einmal sicher, ob ich den Roman veröffentlichen wollte.
Ihr Debüt „Nicht ich“ erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die ihren Mann und ihre Tochter für einen Geliebten verlässt, mit dem es dann aber auch nichts wird. Es ist die Geschichte eines vielfachen Verlusts. Aber sie ist formal ganz anders erzählt als Ihre späteren Romane. Sehr viel experimenteller, die Sprache expliziter. Wie nehmen Sie selbst das wahr?
Shalev: „Nicht ich“ ist auf jeden Fall anders als alle Bücher danach. Es ist mein Erstling, und es hat etwas provokativ Rätselhaftes. Das Buch hat keinen Aufbau, damit unterscheidet es sich sehr von allen meinen späteren Büchern. Er ist bruchstückhaft, eine Art Dekonstruktion. Es hat keine kohärente Handlung, keine realistische Glaubwürdigkeit, vielmehr dicht gepresste seelische Inhalte, und außerdem gibt es viele absurde und groteske Situationen. Ich glaube, es ist mein komischstes Buch.
Es gibt Sequenzen, die wie Albträume anmuten: Die Eltern besorgen der Tochter einen Strichjungen, der sie entjungfert. Oder surreal: Der Mann ist schwanger und die Protagonistin ohne Gebärmutter. Oder: Der Vater wird, nachdem die Kuckucksuhr kaputtgegangen ist, selbst zur Kuckucksuhr und steckt, immer zur vollen Stunde, den Kopf zur Tür rein und ruft irgendwelche Sätze mehrere Male. Das ist wirklich sehr lustig. Wie unterscheidet sich die Schriftstellerin Zeruya Shalev von 1993 von der, die Sie heute sind?
Shalev: Ich bin nicht sicher, dass ich mich so von außen betrachten kann. Es zieht mich heute mehr zu Handlungen als zu den unverhüllten seelischen Prozessen. Es wirkt so, als hätte ich sehr viel mehr Sicherheit und Kontrolle, aber trotzdem fühle ich mich vor dem Bildschirm des Computers oder vor dem Blatt Papier, allein mit den Wörtern, manchmal genauso wie damals.
Nichts ist sicher
Fühlten Sie sich dieser Mutter, die ihre Familie verlässt, ihrem Schmerz und Trotz, damals nahe, oder war sie Ihnen eher fremd?
Shalev: Ich hatte ihr gegenüber ganz unterschiedliche Gefühle. Ich habe versucht, sie nicht zu verurteilen, auch wenn sie schwer erträgliche Dinge sagte. Ich weiß, sie provoziert, aber dahinter spüre ich ihre Verwundungen. Nein, fremd ist sie mir nie gewesen. Als ich studierte, hatte ich eine Nachbarin, älter als ich, die mir einmal erzählte, sie habe ihre Kinder ihrem Mann überlassen müssen, nachdem sie sich in einen anderen Mann verliebt hatte. Ich habe dort nicht lange gewohnt, aber ich weiß noch, ich habe sie angeschaut und mir gedacht, wie viel Schmerz trägt diese Frau die ganze Zeit in ihrem Körper? Irgendwie, Jahre später, als ich selbst Mutter wurde, hat sich dies alles weiterentwickelt, bis es zu diesem Buch wurde.
Israelis struggle to process Hamas attacks
Was der Erzählung die ganze Zeit den Boden unter den Füßen wegzieht, ist das Verhältnis zur Wahrheit. Nichts ist gesichert, die Erzählerin deutet es immer wieder an. Gibt es irgendeine Gewissheit in diesem Roman?
Shalev: Die Heldin erzählt verschiedene und ganz widersprüchliche Versionen über sich und ihre Verluste. Die einzige Gewissheit ist, dass es da einen großen Verlust gab, dass ihre Welt zerbrach. Vermutlich war es ihre Schuld, ihre Entscheidung, und diese Last ist so schwer zu ertragen, dass sie versucht, sie mit den Lesern zu teilen.
Es gibt auch eine politische Komponente. Die kleine Tochter scheint zu Beginn entführt worden zu sein, von Soldaten vom Spielplatz weggeholt und über die Grenze gebracht. Wenn man das heute liest, denkt man sofort an die Geiseln des 7. Oktober 2023, an den Terrorakt der Hamas in Israel. Geht Ihnen das auch so?
Shalev: Das ist schockierend. Seit dem 7. Oktober denke ich daran. Nicht nur dass in einer Version das Mädchen entführt wird, die Erzählerin berichtet im Weiteren auch von Gängen unter dem Kindergarten, in denen ab und zu Kinder verschwinden.
Sie sagt, dass sie, ein paar Monate bevor das Mädchen verschwand, schon gewusst habe, dass sie etwas Schreckliches erwartete . . .
Shalev: … ja, und sie hatte dabei den Kindergarten im Verdacht: „Zu viele unterirdische Gänge führen zu diesem Kindergarten“, sagt sie immer wieder zu ihrem Mann. „Da laufen mir zu viele Leute rum. Ich bin mir sicher, ab und zu verschwindet in diesen Gängen unbemerkt ein Kind.“
Auf was spielten Sie damals an?
Shalev: In „Nicht ich“ steht das alles ohne Zusammenhang. Es ist klar, dass es sich dort um eine innere Realität handelt, nicht um ein tatsächliches Geschehen, aber natürlich sind diese schwer erträglichen Bilder von der Lebenswirklichkeit in Israel beeinflusst, auch dreißig Jahre vor dem 7. Oktober 2023. Als junge Mutter erlebte ich die damaligen Ereignisse in Israel auf einmal doppelt so intensiv. Ebenso alles, was ich in meiner Kindheit und Jugend erlebt hatte – einige Entführungen aus den Siebzigerjahren haben mich sehr beeinflusst –, und auch alles, was passierte, nachdem ich Mutter wurde. Nach der Geburt meiner Tochter lagen auf meinem Bett im Krankenhaus die Zeitungen, die vom Ausbruch der ersten Intifada berichteten. Das Sicherheitsgefühl war erschüttert. Als meine Tochter drei war, haben wir ihr eine Kindergasmaske angemessen und sie später bei jedem Alarm in ein besonderes abgedichtetes Plastikzelt gesetzt, das sie vor der Bedrohung durch die chemischen Waffen im Golfkrieg schützen sollte. Natürlich hinterlassen solche Ereignisse Spuren in den Albträumen, und wenn sich dies mit Schuld, Reue und sehr ambivalenten Gefühlen mischt, gerät alles durcheinander.

"Helft uns, dem Frieden näherzukommen“
Seit dem Krieg in Gaza erhält die Graswurzelbewegung "Standing Together“ von Israelis und Palästinensern immer mehr Zulauf. Sie fordert Frieden und Unabhängigkeit für Israelis und Palästinenser sowie Gleichberechtigung für alle Bürger Israels. Fragen an Itamar Avneri
Sie sind 2004 bei dem Selbstmordattentat eines Palästinensers in Jerusalem schwer verletzt worden. Der Attentäter war ein 24-jähriger Polizist aus Bethlehem, Mitglied der Fatah-nahen Aksa-Märtyrer-Brigaden, er erklärte in seiner Abschiedsbotschaft, seine Tat sei die Rache für eine israelische Militäroperation im Gazastreifen. Sie hat das nicht davon abgehalten, sich immer für die Verständigung von Israelis und Palästinensern einzusetzen. Sie gehörten, gerade im vergangenen Jahr, auch zu den entschiedenen Kritikerinnen der Regierung Netanjahu. Wie stellt sich für Sie die Situation jetzt dar, drei Monate nach dem Massaker der Hamas?
Shalev: Das waren drei entsetzliche Monate, und noch ist kein Ende in Sicht. Ich bin schockiert und trauere. Suche immer wieder Ansätze für Hoffnung. Eine Hoffnung ist das Erwachen der israelischen Zivilgesellschaft, zu dem es während der Proteste gegen die Regierung kam und das sich nun auch in Kriegszeiten fortsetzt, in vielfältigem freiwilligen Engagement dort, wo die Regierung ihre Aufgaben nicht erfüllt und der Staat nicht funktioniert. Es macht Hoffnung, dass sich auch die israelischen Araber in ihrer Mehrheit solidarisch verhalten. Vor ein paar Tagen habe ich bei einem Lichteranzünden der Chanukkakerzen von „Frauen machen Frieden“ auf dem „Platz der Entführten“ in Tel Aviv gesprochen. Es gibt so viele Menschen, so viele Frauen, die dafür kämpfen, dass der jüdisch-arabische Dialog nicht abbricht. Und es gibt auch die Hoffnung, die zu diesem Zeitpunkt zugegeben noch sehr abstrakt erscheint, dass aus diesen furchtbaren Schrecken dann doch etwas Neues, Langlebiges entstehen wird, was eine Chance für Frieden birgt.
Wie ist die Situation in Haifa, wo Sie leben?
Shalev: Bisher war Haifa relativ sicher. Sollte aber die Konfrontation mit der Hizbullah im Norden eskalieren, wird Haifa schwer beschossen werden, so wie beim Zweiten Libanonkrieg.
Es sind immer noch Geiseln in Gefangenschaft.
Shalev: Entsetzlich, sich vorzustellen, was die nach Gaza Entführten durchmachen. Was mit den jungen Frauen passiert, nachdem wir ja gesehen haben, wozu die Hamas fähig ist. Was passiert mit den Alten, den Verwundeten? Die israelische Regierung, der Westen, die USA und alle, denen Menschenrechte etwas wert sind, müssen alles dafür tun, um diese Menschen lebendig aus den Händen dieser sadistischen Terroristen zu befreien.

"Tatsächlich vertraue ich den Aussagen der Hamas"
Der israelische Schriftsteller David Grossman hält auch nach dem Massaker vom 7. Oktober an der Zweistaatenlösung fest. Die Israelis seien dazu verdammt, mit der Hamas Geschäfte zu machen.
Wir sehen, wie die palästinensische Bevölkerung in einer Falle sitzt. Sie werden von Norden nach Süden geschickt, dann wird der Süden angegriffen. Gleichzeitig werden hoch technisierte Tunnelsysteme der Hamas entdeckt. Wohin führt uns das alles?
Shalev: Ich hoffe, es führt dazu, dass die Hamasführer sich ergeben und der Krieg aufhört. Die Situation der Bevölkerung in Gaza bricht einem das Herz. Sie ist ein weiterer Bestandteil dieser großen Tragödie, die die Hamas über unsere ganze Region bringt. Hamas schießt aus Privathäusern, aus Krankenhäusern, missbraucht die Bevölkerung als menschlichen Schutzschild und verweigert ihr den Zugang zu den sicheren Gebieten. Die Menschen in Gaza verdienen eine bessere Führung, die Hamas interessiert sich gar nicht für sie. Ich hoffe, dass dieser fürchterliche Krieg dazu führt, dass sich alle in der Region gegen die extremen Fundamentalisten vereinen. Ich hoffe, dass der Krieg bald enden wird, und dass wir Neuwahlen haben werden, um Netanyahu und seine Regierung loszuwerden.
Sie sind selbst in einem Kibbuz aufgewachsen. Hätte die junge Schriftstellerin Zeruya Shalev, als sie im Café „Nicht ich“ schrieb, für möglich gehalten, dass es jemals zu einer solchen Situation wie der des Massakers kommen könnte?
Shalev: Das lag auch damals leider gar nicht so fern. Der Kibbuz Kinneret, den in den Zwanzigerjahren unter anderem meine Großeltern mit gründeten und in dem meine Mutter aufwuchs, befand sich genau wie die anderen Kibbuzim dieser Gegend 1948 in großer Gefahr. Der erste Mann meiner Mutter, der die Schoa überlebt hat, fiel zusammen mit vielen anderen jungen Leuten im Kampf zur Verteidigung dieser Kibbuzim. Damals bestand kein Zweifel: Würde die syrische Armee die Kibbuzim einnehmen, würde sie dort ein Massaker verüben. Die Geschichten meiner Mutter über diese Zeit trage ich in meiner Erinnerung, und sie kehrten mit entsetzlicher Lebendigkeit am Schabbat des 7. Oktobers zurück. Es scheint, als höre man in den Ereignissen vom 7. Oktober ein Echo der gesamten jüdischen Geschichte.
Interview: Julia Encke
© F.A.S. 2024
Übersetzung aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer
Zeruya Shalev: Nicht ich. Roman; a. d. Hebräischen v. A. Birkenhauer; Berlin Verlag, Berlin 2024; 208 S., 24,– €, als E-Book 19,99 €







