Uralte Traditionen intellektueller Unabhängigkeit

Vor sieben Jahren stürzten Proteste den tunesischen Diktator Zine el-Abidine Ben Ali. Der Funke sprang schnell auf die ganze arabische Welt über, und bald hatten autokratische Herrscher auch in Ägypten, Libyen und Jemen die Macht verloren. In Syrien begann der verheerende Bürgerkrieg. Mit Ausnahme Tunesiens sind aber alle Länder des Arabischen Frühlings heute entweder wieder Diktaturen oder gescheiterte Staaten.
Beobachter streiten darüber, ob Tunesien ein Leuchtturm der Hoffnung in einer krisengeschüttelten Weltgegend oder ein Sonderfall ist, der nicht als Modell taugt. Safwan M. Masri von der Columbia University gehört zur zweiten Gruppe.
In seinem kürzlich erschienenen Buch "Tunisia – An Arab anomaly" erläutert er die vielen Unterschiede zwischen Tunesien und anderen arabischen Ländern. Ihm zufolge reichen die Gründe dafür, dass Tunesien eine besondere nationale Identität und eine lebendige Zivilgesellschaft hat, weit in die Geschichte zurück:
Historisch bedingte organisierte Staatlichkeit
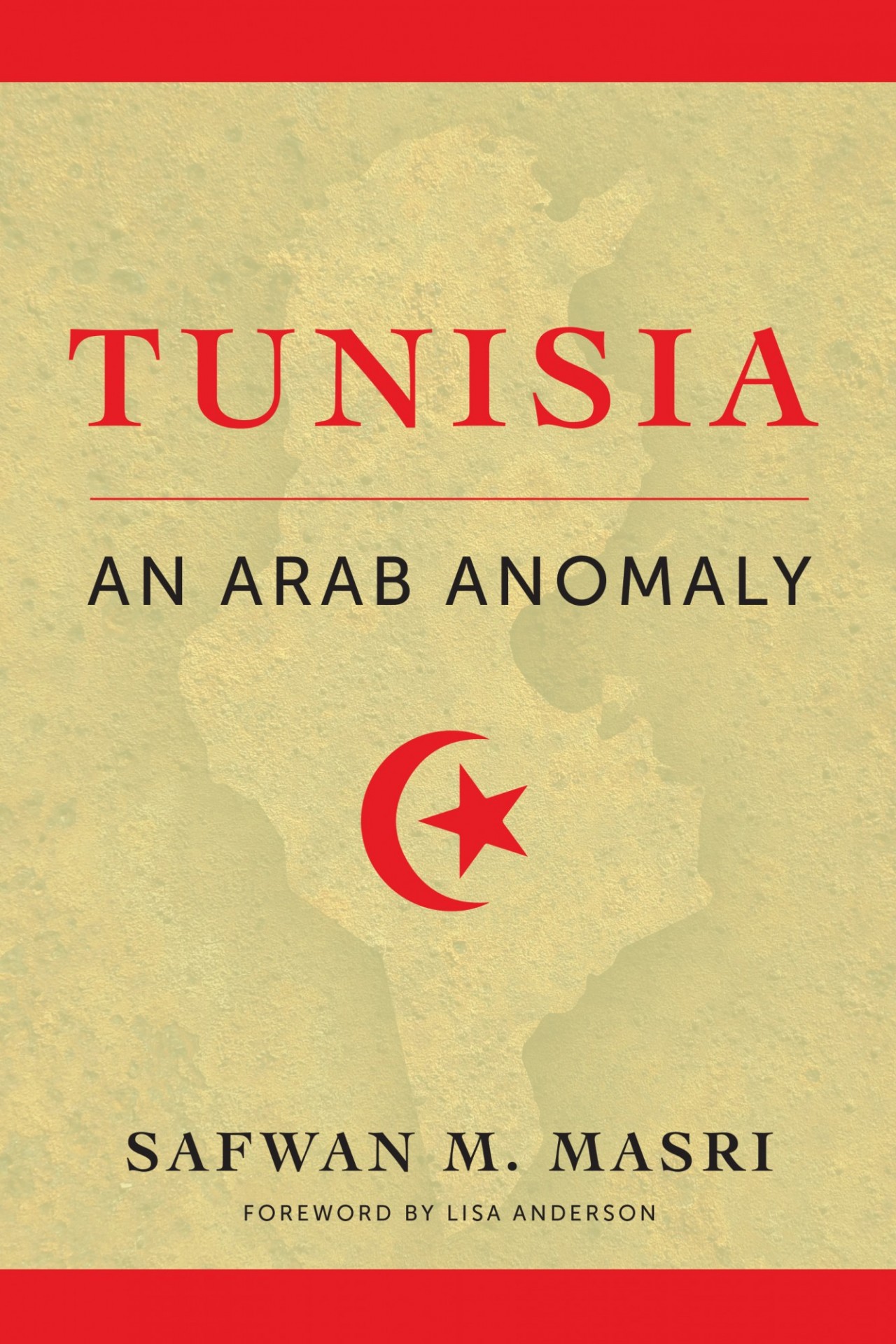
1. Organisierte Staatlichkeit gibt es in Tunesien seit Karthago, der Stadt, die vor mehr als 2000 Jahren der Konkurrent Roms war und dann von Rom erobert wurde. Die heutigen Landesgrenzen entsprechen denen der damaligen römischen Provinz.
Dank seiner Lage war Tunesien immer ein Zentrum des Mittelmeerhandels mit urbaner Kultur und vergleichsweise guter Infrastruktur. Stammeszugehörigkeit spielte deshalb eine geringere Rolle als anderswo in Nordafrika und dem Nahen Osten.
2. Nach der arabischen Eroberung im späten siebten Jahrhundert wurde die Stadt Kairouan eine Hochburg muslimischer Gelehrsamkeit. Tunesien bildete eine eigene Version des sunnitischen Islams heraus, die regionale Traditionen integrierte, und hatte durchgehend wechselnde Zentren intellektueller Exzellenz.
Das Land war weit genug von anderen muslimischen Machtzentren entfernt, um von diesen nicht dominiert zu werde, stand aber immer in Kontakt mit Europa.
3. Im 19. Jahrhundert entwickelten tunesische Intellektuelle Modernisierungskonzepte. Neue Bildungseinrichtungen wurden geschaffen, und einige von ihnen hatten mit dem Glauben nichts zu tun. Weltliche und religiöse Schulen pflegten regen Austausch untereinander.
Tunesien setzte der Sklaverei vor den USA ein Ende, und seine Intellektuellen sprachen sich früh für Frauenrechte aus.
4. Habib Bourguiba, der autokratische Herrscher, der Tunesien in die Unabhängigkeit führte, baute auf Tunesiens Besonderheiten auf. Er wandte sich gegen den Panarabismus, der die imperialen Mächte für alle Probleme verantwortlich machte, aber wenig zur positiven Entwicklung beitrug.
Bourguiba investierte in das bilinguale französisch-arabische Bildungswesen, in dem der Glaube nicht sonderlich betont wurde. Die Gewerkschaften behielten Freiräume, und das Familienrecht stellte Frauen besser als in anderen Ländern der Region. Bourguibas Militärausgaben blieben gering, weil er die Armee nicht zu einem Machtzentrum machen wollte.
Tunesien – ein relevantes Vorbild
Masri erläutert überzeugend, dass uralte Traditionen intellektueller Unabhängigkeit und staatlicher Zusammengehörigkeit das heutige Tunesien prägen sowie dass Bourguiba auf dieser Basis trotz seiner autoritären Haltung die Gesellschaft modernisierte.
Der langfristige Erfolg von Tunesiens junger Demokratie ist aber alles andere als gewährleistet. Masri findet vielversprechend, dass die islamistische Ennahda sich als Partei mit demokratischen Muslimen neu definiert hat. Er räumt aber auch ein, dass Terrorismus ein Problem ist und dass fanatische Extremisten die Demokratie scheitern sehen wollen.
Augenscheinlich betrachten die Fanatiker Tunesien eben doch als potenzielles Modell, und das ist angesichts des Tempos, in dem der Arabische Frühling auf andere Länder übersprang, auch plausibel.
Offensichtlich identifizierten sich Menschen in anderen Ländern mit dem, was in Tunesien geschah. Tunesien taugt sicherlich nicht als Blaupause, aber sein Vorbild ist relevant. Nationen lernen voneinander, auch wenn die Ausgangsbedingungen unterschiedlich sind. Entscheidend ist, ob Menschen die Entwicklung anderswo verfolgen und auf sich selbst beziehen.
Hans Dembowski
